 Delmenhorster Richter beschneidet Bäume kurzerhand selbst.
Delmenhorster Richter beschneidet Bäume kurzerhand selbst.
Die Pressestelle des Oberlandesgerichts Oldenburg teilte im September 2011 einen kuriosen Fall aus dem eigenen Gerichtsbezirk mit.
Gerichte entscheiden täglich über zahlreiche Rechtsstreitigkeiten mit durchdachten Urteilen und Beschlüssen. Das muss aber nicht immer so sein. Manchmal ist eine praktische und schnelle Lösung mit scharfem Werkzeug die einfachste und beste.
Das hat sich auch ein Amtsrichter aus Delmenhorst gesagt, als er den langjährigen Streit zwischen zwei Grundstücksnachbarn über den Bewuchs entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze zu entscheiden hatte. Während der eine Nachbar darauf bestand, dass keine Zweige und Äste auf sein Grundstück hinüber wachsen, war es dem anderen Nachbar wichtig, dass sich die Bäume und Sträucher in seinem Garten möglichst natürlich entfalten können.
Ein früherer Vergleich vor dem Schiedsmann ließ sich trotz anwaltlicher Hilfe nicht in eindeutige Handlungsanweisungen umsetzen. So stritten die Nachbarn vor Gericht weiter. Der zuständige Amtsrichter ordnete kurzerhand einen Ortstermin gemeinsam mit den streitenden Parteien und ihren Anwälten an. Dort war schnell klar, es muss eine unwiderrufliche und praktische Entscheidung her.
Der Richter bat die eine Partei um eine scharfe Astschere und die andere Partei um eine ebensolche Bügelsäge. Statt endloser juristischer Diskussionen ging er jeden Baum und jeden Strauch Ast für Ast mit den Parteien durch und legte mit Zustimmung der Parteien selber Hand an.
Der Streit erledigte sich im Handumdrehen. Die Parteien akzeptierten diese praktische Lösung und der Rechtsstreit konnte beendet werden. Allerdings muss der Amtsrichter jetzt noch über die Kosten des Rechtsstreits entscheiden.
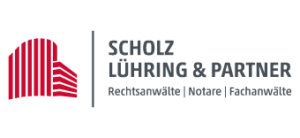
 Der Bundesgerichtshof hat am 28.09.2011– VIII ZR 242/10- eine Entscheidung zu den Anforderungen an die gemäß § 554 Abs. 3 BGB erforderliche Modernisierungsankündigung getroffen.
Der Bundesgerichtshof hat am 28.09.2011– VIII ZR 242/10- eine Entscheidung zu den Anforderungen an die gemäß § 554 Abs. 3 BGB erforderliche Modernisierungsankündigung getroffen. Der Sinn von neuen Gesetzen ist manchmal unklar. Mit der Einführung des neuen „Zentralen Testamentsregisters“ zum 01.01.2012 setzt der Gesetzgeber allerdings eine von der Praxis lange geforderte Neuregelung endlich um.
Der Sinn von neuen Gesetzen ist manchmal unklar. Mit der Einführung des neuen „Zentralen Testamentsregisters“ zum 01.01.2012 setzt der Gesetzgeber allerdings eine von der Praxis lange geforderte Neuregelung endlich um. Brauchen Sie eine Rechnung? Können wir das nicht „auch so“ machen? Diese Fragen werden vor einer Auftragsvergabe immer offener gestellt und gemeint ist stets das Erbringen von Bauleistungen ohne Rechnung, also Schwarzarbeit.
Brauchen Sie eine Rechnung? Können wir das nicht „auch so“ machen? Diese Fragen werden vor einer Auftragsvergabe immer offener gestellt und gemeint ist stets das Erbringen von Bauleistungen ohne Rechnung, also Schwarzarbeit.